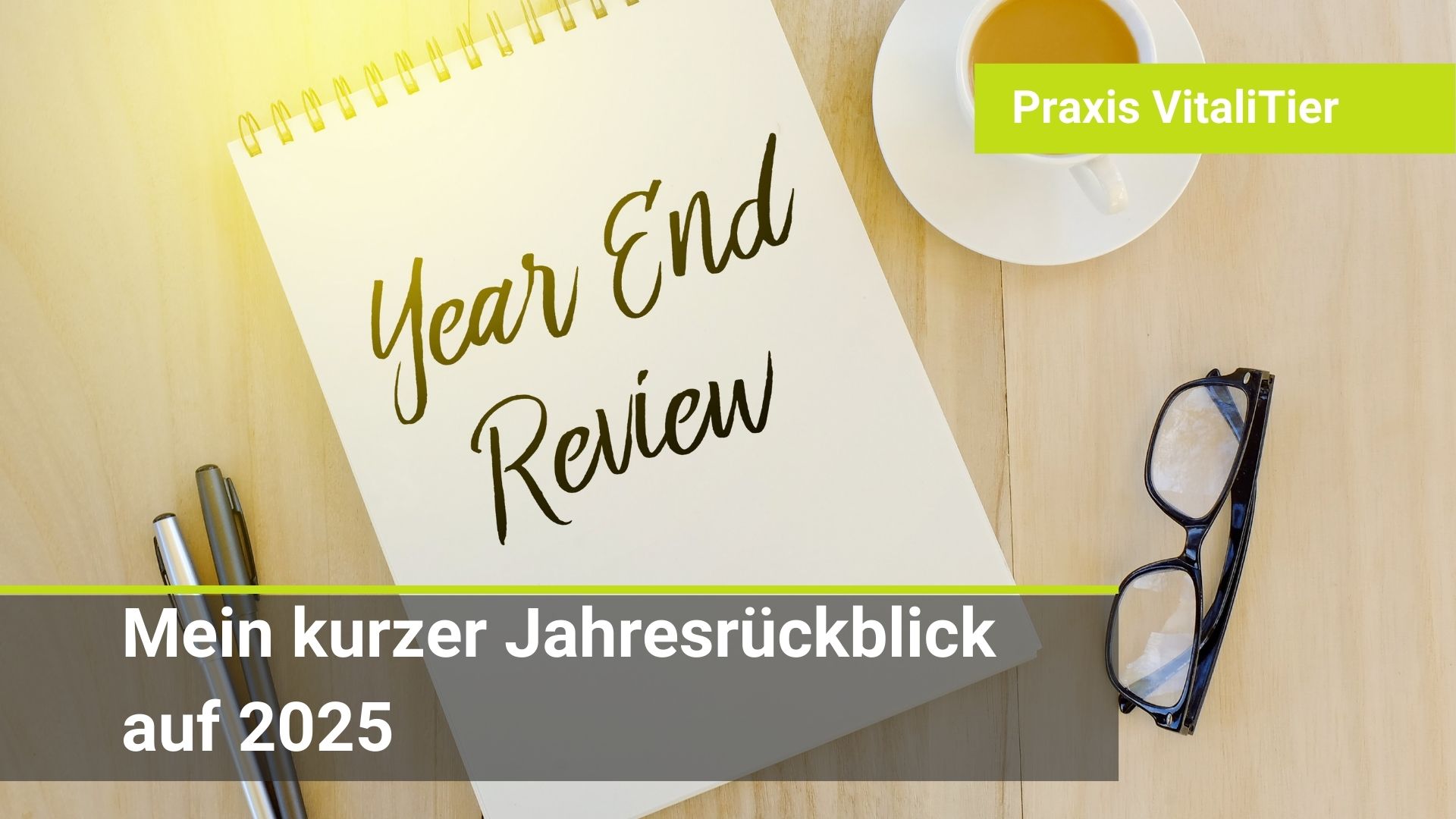Leben mit chronisch krankem Hund – Teil 1
Es gibt Momente im Leben, die gefühlt alles verändern. Einen solchen Moment erlebst du vielleicht, wenn der Tierarzt dir mitteilt, dass dein Hund an einer chronischen Krankheit leidet. Plötzlich steht die Zeit still, die Worte verhallen irgendwo zwischen deinen Ohren und deinem Herz, und du fragst dich: „Was bedeutet das jetzt für uns?“
Ich kenne diese Situation aus zwei Blickwinkeln: Als Tierphysiotherapeutin erlebe ich seit vielen Jahren Hundebesitzer, die nach solchen Momenten bei mir in der Praxis landen, hauptsächlich natürlich bei chronischen orthopädischen Erkrankungen wie Hüftdysplasie, Ellbogendysplasie, Spondylose etc.
Gleichzeitig lebe ich seit 19 Jahren mit chronisch kranken Hunden und weiß daher auch aus eigener Erfahrung, wie sich dieser Boden unter den Füßen wegziehen anfühlt.
Diese doppelte Perspektive – und die daraus resultierende emotionale Belastung – hat mich schließlich dazu bewogen, zusätzlich eine Ausbildung zur Stress-Coachin zu absolvieren.
Denn eines habe ich gelernt: Die Diagnose trifft nicht nur unsere Hunde, sie trifft auch uns.
Der Moment, der Diagnose “chronisch kranker Hund”
Vielleicht steckt schon ein längerer Krankheitsweg dahinter oder die Diagnose kam völlig überraschend nach einer Routineuntersuchung. Egal wie – in dem Moment, wo Worte wie „chronisch“, „unheilbar“ oder „lebenslang“ fallen, zieht sich unser Herz zusammen.
Das ist völlig normal und absolut verständlich.
Ich hatte bei meinen Hunden durchaus unterschiedliche Reaktionen.
Malou:
Bei meiner alten Tierschutz-Hündin war ich recht gefasst. Wenn man einen 11 Jahre alten Hund aus dem Ausland adoptiert, sollte man meiner Meinung nach nicht erwarten, dass alles “glatt läuft”. Dennoch war es in meiner Situation als Studentin ein Schreck zu erfahren, wie krank sie eigentlich war. Wie sagte ich immer: Zum Leben zu viel, zum Sterben zu wenig. 5 Jahre lang habe ich sie intensiv gepflegt.

Malou führte mich mit ihren vielen chronischen Krankheiten zur Tierphysiotherapie. Bild: VitaliTier
Flynn:
Bei Flynn, meinem inzwischen 13-jährigen Rüden, kam die Diagnose einer seltenen Autoimmunerkrankungen im Alter von 12 Wochen. Ich habe tagelang geweint, denn man gab ihm ca. 2 Jahre an Lebenserwartung. Flynn hat mich einige Nervenzusammenbrüche gekostet und er hat mir ganz viele Erkenntnisse und Weiterentwicklung geschenkt.

Flynn hat mir persönliche Weiterentwicklungen geschenkt. Trotz aller Kraft, die das Leben mit ihm kostet, ich würde ihn nicht missen wollen. Bild: VitaliTier
Yuno:
Bei Yuno, meinem Jüngsten, war und ich bin phasenweise immer noch unfassbar wütend. Wütend auf die Züchterin, die sich schlecht entschieden hat. Wütend auf mich, dass ich mir wieder “den Falschen” ausgesucht hatte, wütend auf das Universum, dass ich nun 2 chronisch kranke Hunde liebe. Wütend auf TÄ, die mir nicht geglaubt haben und viel zu spät meine Verdachtsdiagnosen bestätigt haben und ihm damit gute Möglichkeiten genommen haben.

Yuno ist eine doppelte Herausforderung, da er nicht nur körperlich chronisch krank ist. Er hat mich auch schon an meine Grenzen gebracht. Aber bislang gehen wir gestärkt daraus hervor. Bild: VitaliTier
In meiner Praxis erlebe ich auch unterschiedliche Reaktionen. Deine Reaktion ist deine Reaktion – und sie ist berechtigt.
Der Schock bei einem chronisch kranken Hund
Wenn wir einen Schock erleben – und das kann so eine Diagnose für den eigenen Hund sein – schaltet unser Gehirn in einen Überlebensmodus. Das bedeutet: Deine Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und rational zu denken, ist in diesem Moment stark eingeschränkt. Das erklärt, warum du möglicherweise nur die Hälfte von dem verstanden hast, was der Tierarzt gesagt hat, oder warum dir erst zu Hause hundert Fragen eingefallen sind.
Aus neurobiologischer Sicht ist das ein völlig normaler Schutzreflex. Dein Körper will dich vor Überforderung bewahren. Gleichzeitig kann das aber auch bedeuten, dass wichtige Informationen nicht richtig ankommen. Deshalb ist es so wichtig, dass du dir bewusst machst: Du musst nicht sofort alles verstehen oder Entscheidungen treffen.
Die Zeit unmittelbar nach der Diagnose ist oft geprägt von einem Wechselbad der Gefühle. Vielleicht spürst du:
- Ungläubigkeit: „Das kann nicht sein, der Hund war doch gestern noch völlig normal.“
- Angst: „Was kommt jetzt auf uns zu? Wird er leiden müssen?“
- Schuldgefühle: „Hätte ich früher zum Tierarzt gehen müssen?“
- Überforderung: „Wie soll ich das alles schaffen?“
- Trauer: „Nichts wird mehr so sein wie früher.“
All diese Gefühle sind berechtigt und wichtig. Sie zeigen, wie sehr du deinen Hund liebst. Gleichzeitig können sie dich lähmen, wenn du ihnen zu viel Raum gibst.
Stress durch das Leben mit einem chronisch kranken Hund
Hier kommt eine wichtige Wahrheit, die ich über die Jahre gelernt habe: Dein Hund spürt deine Emotionen.
Über einige Zeit spielte sich leider zwischen Flynn und mir Folgendes ab: Bei jedem Mal husten, das von ihm kam, krampfte ich zusammen (Husten war ein Anzeichen für einen wahrscheinlichen Rückfall im Rahmen der Erkrankung). Hustete er dann ein zweites Mal, brach ich schon weinend zusammen. Das führte dazu, dass Flynn nach jedem Husten sich ducke und davon schlich. Wir waren beide hochgradig im Stress gefangen. Zum Glück ist diese ungute Symbiose seit vielen Jahren vorbei. Ich kann inzwischen souverän mit seinem Husten umgehen. Das musste ich aber lernen.

Als Team gemeinsam mit der chronischen Erkrankung leben: Oft anstrengend, aber nicht mit weniger Liebe.
Das bedeutet nun nicht, dass du deine Gefühle unterdrücken sollst. Es bedeutet nur, dass du dir bewusst Räume schaffen sollest, in denen du sie auslebst – ohne deinen Hund zu belasten. Weine ruhig, wenn er schläft. Rede mit Freunden, wenn er mit seinem Lieblingsspielzeug beschäftigt ist oder nicht anwesend ist
Erste praktische Schritte bei der Diagnose “chronisch kranker Hund”
Wenn der erste Schock verdaut ist, helfen konkrete Handlungen dabei, wieder ein Gefühl der Kontrolle zu bekommen:
- Informationen sammeln: Notiere dir alle Fragen, die dir einfallen, und vereinbare einen Folgetermin mit deinem Tierarzt oder Hundephysiotherapeuten. Oft ist es hilfreich, eine Vertrauensperson mitzunehmen, die mitschreibt und nachfragt.
- Zweitmeinung einholen: Bei schwerwiegenden Diagnosen ist es völlig legitim, eine weitere fachliche Meinung einzuholen. Das ist kein Misstrauensvotum gegen deinen Tierarzt, sondern zeigt, dass du verantwortungsbewusst handelst.
- Dein Support-Netzwerk aktivieren: Informiere Menschen, die dir nahestehen, über die Situation. Du wirst Unterstützung brauchen – praktisch und emotional.
- Routinen beibehalten: So weit wie möglich solltest du die gewohnten Abläufe mit deinem Hund beibehalten. Das gibt euch beiden Sicherheit.
Du bist nicht allein
Das Gefühl, mit der Situation allein zu sein, ist eines der belastendsten Aspekte einer chronischen Krankheit beim Hund. Dabei sind wir eine große, wenn auch unsichtbare Gemeinschaft. Millionen von Hundebesitzern weltweit leben mit chronisch kranken Hunden und meistern jeden Tag aufs Neue die Herausforderungen, die damit verbunden sind.
In den kommenden Artikeln dieser Serie werde ich dir zeigen, wie du den Alltag mit einem chronisch kranken Hund organisieren kannst, welche emotionalen Höhen und Tiefen auf dich warten und wie du trotz allem wunderbare, erfüllte Jahre mit deinem Hund verbringen kannst.
Denn das ist das Wichtigste, was ich dir nach 19 Jahren mit chronisch kranken Hunden sagen kann: Man kann auch mit so einem Hund und so einem gemeinsamen Leben Glücksmomente erleben.
Im nächsten Artikel der Serie geht es darum, wie du deinen Alltag mit einem chronisch kranken Hund neu organisierst und welche praktischen Hilfen dir dabei nützlich sein können.
Du möchtest die Veröffentlichung des nächsten Teiles nicht verpassen? Dann melde ich gerne zu meinem kostenlosen Newsletter an: